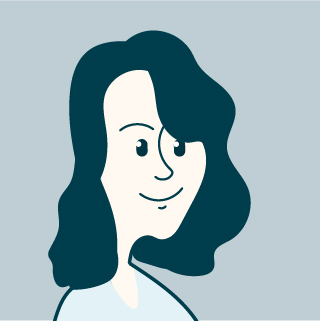Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen – reden wir darüber!
18. Juni 2024 | Kommentar(e) |
Emma Raposo

Über chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) wird nur wenig gesprochen, und das obwohl fast 40 000 Menschen in der Schweiz davon betroffen sind. Was sind CED? Sind sie heilbar oder lassen sich die Beschwerden lindern? In diesem Artikel geben wir einen Überblick über diese Erkrankungen, die in den letzten Jahrzehnten immer häufiger auftreten.
Was genau sind CED?
Chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen liegt eine Überreaktion des Immunsystems im Darm zugrunde. Die beiden häufigsten CED sind:
- Colitis ulcerosa, eine chronische Entzündung der Schleimhaut des Dickdarms und des Rektums.
- Morbus Crohn, eine chronische Entzündung des Verdauungsstraktes. Sie verläuft in Schüben, abgewechselt mit Remissionsphasen, und kann alle Abschnitte des Verdauungstraktes – vom Mund bis zum After – betreffen. Meistens tritt sie jedoch im unteren Abschnitt des Dünndarms oder im oberen Abschnitt des Dickdarms auf.
Beide Erkrankungen werden früh diagnostiziert, da sie in der Regel zwischen 15 und 30 Jahren auftreten, bei Morbus Crohn in 80 Prozent der Fälle sogar vor dem Alter von 25 Jahren. Besorgniserregend ist, dass die Häufigkeit dieser Erkrankungen in den letzten 40 Jahren zugenommen hat.
Wie lässt sich der Anstieg dieser Erkrankungen erklären?
Es sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen, selbst wenn die genauen Ursachen noch unklar sind. Neben einer genetischen, aber nicht vererbbaren Anfälligkeit lässt sich die Zunahme von Krankheitsfällen möglicherweise durch die Ernährung, die bei der Zusammensetzung des Darm-Mikrobioms eine entscheidende Rolle spielt, sowie verhaltensbedingte Faktoren wie Rauchen und Umweltfaktoren (Umweltverschmutzung usw.) erklären.
CED erhöhen auch das Risiko für die Entstehung von Dickdarmkrebs oder Kolorektalkrebs. CED-Patient*innen haben zehn Jahre nach der Erstdiagnose ein 2- bis 2,5-mal höheres Risiko, an dieser Art von Krebs zu erkranken. Nach 30 Jahren haben sie ein 5-mal höheres Risiko. Wie hoch das Risiko ist, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie dem Schweregrad der Entzündung, der kumulativen Entzündungsdauer in der Vergangenheit und dem Alter des Patienten oder der Patientin.
Welche Symptome treten bei CED auf und wie lassen sie sich behandeln?

Stellen Sie sich eine fiese, anhaltende Magen-Darm-Grippe vor. Anders gesagt zählt Folgendes zu den Symptomen:
- Fieber
- Müdigkeit
- Gelenkschmerzen
- Anhaltender Durchfall (manchmal blutig)
- Gewichtsverlust
Neben den Beschwerden im Magen-Darm-Trakt können bei Menschen mit CED auch Symptome wie Aphten im Mundraum sowie Haut- und Augenbeschwerden auftreten. Zwar sind diese von aussen meist nicht sichtbar, sie beeinträchtigen den Alltag der Betroffenen jedoch stark.
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen sind nicht heilbar. Die Behandlung besteht in der Linderung der Beschwerden. Ziel ist es, lange Remissionsphasen zu erreichen und aufrechtzuerhalten sowie neuen Schüben vorzubeugen. CED-Patient*innen werden mit Medikamenten behandelt. Ein chirurgischer Eingriff wird dagegen nur als letztes Mittel eingesetzt, wobei in den schwersten Fällen unter Umständen ein Stomabeutel ausserhalb des Körpers angebracht wird.
Kann die Ernährung helfen, die Beschwerden zu lindern?
Die Forschung konnte Zusammenhänge zwischen einer unausgewogenen Darmflora und der Entstehung von entzündlichen Erkrankungen feststellen. Die Forschenden untersuchen daher unter anderem, wie sich die Wiederherstellung einer gesunden Darmflora bei Betroffenen auswirkt. Erforscht wird zudem die Rolle von Probiotika, welche die Darmflora wieder ins Gleichgewicht bringen sollen.
Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit unseres Darms. Zwar konnte die Wirksamkeit einer bestimmten entzündungshemmenden Diät in keiner Studie nachgewiesen werden, Studien deuten jedoch darauf hin, dass sich eine pflanzliche Ernährung à la Mittelmeer-Diät sowohl bei der Prävention als auch der Therapie von CED vorteilhaft auswirkt. Ausserdem gilt es, den Zustand jedes einzelnen Patienten und jeder einzelnen Patientin zu berücksichtigen und die Ernährung auf seine oder ihre spezifischen Bedürfnisse auszurichten. So kann die Ernährung speziell an die verschiedenen Krankheitsphasen – Remissionsphase oder akuter Schub – angepasst werden. Die Betreuung durch eine spezialisierte Fachperson ist daher notwendig.

Ganz allgemein ist auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung zu achten. Hochverarbeitete Lebensmittel sind unbedingt zu meiden. Zu bevorzugen sind frische und wenig verarbeitete Lebensmittel. Ausserdem sollten sehr fettige, salzige und süsse Produkte vermieden werden. Empfohlen wird ausserdem, Fisch und andere Meeresfrüchte, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, sowie weisses Fleisch zu essen. Zu rotem Fleisch sollte man nur ein bis zwei Mal pro Woche greifen. Fettarme Zubereitungsmethoden wie etwa mit Dampf oder im Ofen und pflanzliche Proteine sind zu bevorzugen. Von Koffein und scharfen Speisen wird abgeraten, da sie die Symptome von CED verschlimmern können. Und nicht zuletzt ist stets auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten, insbesondere, wenn man an Durchfall leidet. Auf Alkohol und Tabak sollte verzichtet werden.
Die Ernährung zielt in erster Linie darauf ab, die Entzündung und damit die Symptome zu reduzieren, und dabei gleichzeitig die notwendigen Nährstoffe zu liefern. Es macht wenig Sinn, sich einzuschränken, ohne vorher gemeinsam mit einer Gesundheitsfachperson seine Bedürfnisse genau zu eruieren. Alle Patient*innen sind anders und benötigen einen individuell auf ihre Situation zugeschnittenen Ernährungsplan. Eines darf man jedoch nicht vergessen: Essen sollte trotz Krankheit stets ein Genuss bleiben.